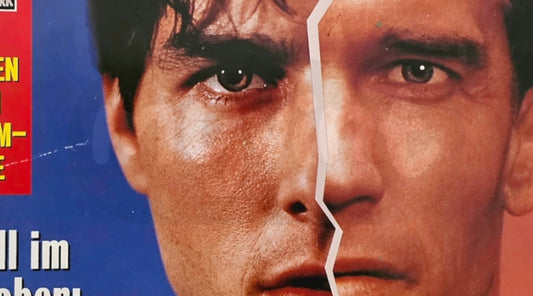Wie Filmzeitschriften Meinungen über Filme prägten
In der Ära vor dem Internet waren Filmzeitschriften zentrale Meinungsbildner. Ihre Kritiken entschieden mit darüber, ob ein Film zum Flop oder Kultklassiker wurde. Kolumnist:innen prägten Debatten, Magazine führten mediale Kampagnen – und ihre Wertungen wurden von Verleihern auf Plakaten zitiert. Der redaktionelle Einfluss reichte weit über Informationsvermittlung hinaus: Er formte Erwartungen, Karrieren und nicht zuletzt das kulturelle Ansehen ganzer Filmepochen.
Presse als Filmkritiker: Rolle von Redaktionen
Die Filmzeitschrift war nicht nur Informationsorgan, sondern auch kulturelle Instanz. Redaktionsteams wählten gezielt Themen aus, setzten Schwerpunkte und positionierten sich ästhetisch oder politisch. Besonders in Magazinen wie Filmkritik (BRD), Cahiers du Cinéma (Frankreich) oder Sight & Sound (UK) wurde der Film diskursiv verhandelt. In populären Heften wie Cinema oder Premiere stand die Bewertung zwar stärker im Fokus, doch auch hier entschieden redaktionelle Linien über Sichtbarkeit und Gewichtung.
Einflussreiche Kolumnen und Filmkritiken
Einzelne Kolumnen oder Autorenstimmen entwickelten eine hohe Reichweite. In Deutschland etwa Fritz Göttler, Karsten Witte oder später Rüdiger Suchsland; international Pauline Kael (The New Yorker), Roger Ebert (Chicago Sun-Times), André Bazin (Cahiers du Cinéma). Ihre Kritiken galten nicht nur als Empfehlung, sondern oft als Maßstab für Qualität – und wurden auch in Fachkreisen ernst genommen.
Zitate aus Magazinen auf Filmplakaten
Ein typisches Phänomen seit den 1980er-Jahren war das gezielte Zitieren positiver Rezensionen auf Filmplakaten, DVD-Hüllen oder Kinotafeln. Aussagen wie „Der beste Film des Jahres“ oder „Ein Muss für Cineasten“ stammten häufig aus bekannten Zeitschriften. Besonders prägnant: Zitate aus Cinema, Moviestar, Fangoria oder internationalen Leitmedien wie Variety und Empire. Der redaktionelle Kommentar wurde so zur direkten Werbebotschaft – mit messbarem Einfluss auf den Filmerfolg.
Beispiel: Wie Kritiken Karrieren beeinflussten
Ein prominentes Beispiel ist die internationale Rezeption von Rainer Werner Fassbinder. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Filme lange ablehnte, verschaffte die wohlwollende Kritik in Filmkritik und Cahiers du Cinéma seiner Karriere früh intellektuelle Legitimation. Auch Quentin Tarantino verdankte seine europäische Popularität in Teilen der begeisterten Rezeption durch Magazine wie Positif, Empire oder Cinema, lange bevor sich der Mainstream anschloss.
Themenwahl und politische Tendenzen
Redaktionen prägten durch Themenwahl und Rahmung auch politische Deutungen von Filmen. Während konservative Magazine eher Wert auf Unterhaltung und Starporträts legten, rückten linke oder akademische Zeitschriften Aspekte wie Gesellschaftskritik, Gender oder Repräsentation in den Fokus. Filmzeitschriften waren damit Teil gesellschaftlicher Auseinandersetzung – etwa bei Debatten über Gewalt im Kino, Feminismus oder Zensur.
Filmzeitschriften als Meinungsführer
Besonders in den 60er- bis 90er-Jahren fungierten Filmzeitschriften als sogenannte Gatekeeper. Sie entschieden, welche Filme im Feuilleton beachtet, in Programmkinos aufgenommen oder für Festivals empfohlen wurden. Ihre Einordnung war für Kritiker:innen, Kinobetreiber:innen und Verleiher handlungsleitend – sowohl im Arthouse-Segment als auch im kommerziellen Bereich. Auch die Einführung von Sternebewertungen oder Punktesystemen ab den 80er-Jahren beeinflusste die öffentliche Wahrnehmung spürbar.
Leserbriefe und Feedback in der Printkultur
Vor dem digitalen Kommentarwesen war der Leserbrief zentrale Form des Rückkanals. Viele Magazine wie Cinema, Fangoria oder Moviestar hatten eigene Leserbriefseiten, auf denen kontroverse Meinungen, Korrekturen oder Lob Platz fanden. Diese Dialogkultur trug zur Bindung zwischen Redaktion und Leserschaft bei – und spiegelte oft auch gesellschaftliche Spannungen. Manche Redaktionen bezogen offen Stellung zu Leserreaktionen, was die redaktionelle Linie zusätzlich profilierte.
Kampagnen durch Filmmedien
Einige Zeitschriften nutzten ihre Reichweite für medienwirksame Kampagnen – etwa zur Rettung kleiner Kinos, zur Förderung bestimmter Genres (z. B. deutsches Genrekino) oder zur Wiederveröffentlichung klassischer Filme. Auch Boykottaufrufe gegen bestimmte Produktionen oder Appelle zur FSK-Debatte wurden von Redaktionen lanciert. In solchen Fällen war die Filmzeitschrift nicht nur Spiegel, sondern aktiver Akteur im kulturellen Feld.
Kontroverse Rezensionen im Rückblick
Rückblickend sind viele Kritiken aus vergangenen Jahrzehnten selbst zu Zeitdokumenten geworden. Filme wie Blade Runner, Fight Club oder 2001: Odyssee im Weltraum wurden bei Erscheinen in Teilen der Presse abgewertet oder missverstanden – heute gelten sie als Meisterwerke. Diese Fehlurteile sind lehrreich: Sie zeigen, wie stark zeitliche, gesellschaftliche und ästhetische Kontexte den Blick auf ein Werk beeinflussen können.
Heute digitale Rezension, damals redaktioneller Einfluss
Heute wird filmische Meinung vielfach über Blogs, Social Media oder Videoformate vermittelt – oft spontaner, fragmentierter, aber auch demokratischer. Der Einfluss einzelner Printredaktionen ist geschrumpft, doch ihr Erbe bleibt spürbar: Viele Argumentationsmuster, Bewertungsformen oder Reputationen stammen aus jener Zeit, in der Filmzeitschriften als Instanzen galten. Für die Filmgeschichtsschreibung bleiben sie unverzichtbare Quellen.
Quellen:
Filmkritik lesen, Hg. J. Bock & M. Horak (2020)
Cinema Archiv, Sammlung CineGraph Hamburg
Cahiers du Cinéma – digitale Ausgabe & Printarchiv
Oral History Projekt „Filmkritik & Öffentlichkeit“, Uni Wien
Deutsche Kinemathek: Sammlung Pressehefte & Reaktionen