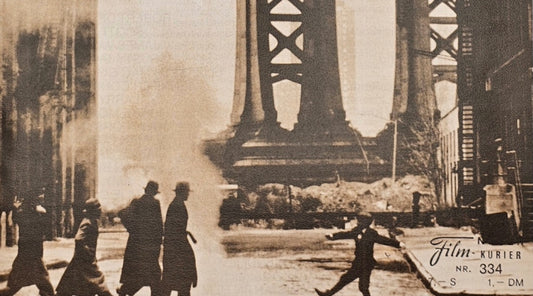Kinoprogramme digitalisieren – sinnvoll oder nicht?
Die Digitalisierung historischer Kinoprogramme eröffnet neue Möglichkeiten der Erschließung, Archivierung und Präsentation. Gleichzeitig stellt sie Sammler, Archive und Forschungseinrichtungen vor technische, rechtliche und kuratorische Herausforderungen. Wann lohnt sich die Digitalisierung? Welche Verfahren eignen sich? Und was geht dabei womöglich verloren? Der folgende Beitrag bietet eine fundierte Einschätzung zum digitalen Umgang mit analogen Programmheften.
Vor- und Nachteile der Digitalisierung
Die Vorteile der Digitalisierung liegen auf der Hand: Schutz vor physischem Verfall, bessere Durchsuchbarkeit, einfache Vervielfältigung und weltweite Zugänglichkeit. Für Archive und Forschungseinrichtungen ist sie ein essenzielles Mittel zur Bestandssicherung.
Gleichzeitig gehen haptische, materielle und visuelle Eigenschaften des Originals teilweise verloren. Papierstruktur, Drucktechnik, Falze oder handschriftliche Einträge lassen sich nur bedingt digital erfassen. Auch für Sammler ist das Original oft das eigentliche Objekt der Begierde – die digitale Version bleibt Hilfsmittel, nicht Ersatz.
Technische Möglichkeiten im Überblick
Für die Digitalisierung von Kinoprogrammen kommen zwei Hauptverfahren infrage: Flachbettscannen und fotografische Reprotechnik. Flachbettscanner sind besonders geeignet für Standardformate und liefern exakte Reproduktionen mit hoher Farbtreue. Bei empfindlichen oder überformatigen Heften ist die fotografische Erfassung mit Auflicht- oder Buchscannern oft schonender. Für den Massenscan ist die Nutzung automatisierter Dokumentenscanner denkbar – jedoch nur bei robuster Bindung.
Scannen vs. Fotografieren
Scannen bietet höchste Präzision bei gleichmäßiger Ausleuchtung, ideal für detailgetreue Archivierung. Fotografieren ist flexibler, etwa bei dreidimensionalen oder beschädigten Programmen. Dabei ist auf parallele Ausrichtung, verzerrungsfreie Objektive und kontrollierte Lichtführung zu achten. In beiden Fällen gilt: keine Kompression im Scanprozess, idealerweise mindestens 300 dpi, für Archivkopien 600–1200 dpi.
Dateiformate und Archivierung
Empfohlene Formate für die Langzeitarchivierung sind TIFF (verlustfrei, speicherintensiv), PNG (verlustfrei, für Webdarstellung), PDF/A (standardisiert für digitale Bibliotheken) und JPEG (nur für Präsentationszwecke). Die Ablage sollte klar strukturiert erfolgen – nach Titel, Jahr, Kino oder Herkunft. Wichtiger Bestandteil der digitalen Archivierung ist ein redundantes Backup-System auf physischem und Cloud-basiertem Speicher.
Metadaten sinnvoll einsetzen
Jede Digitalisat sollte mit präzisen Metadaten versehen werden: Titel, Ort, Datum, Verleih, Sprache, Format, Besonderheiten. Standards wie Dublin Core oder METS/ALTO bieten geeignete Strukturen. Für private Sammlungen reicht oft eine einfache Tabellenstruktur, für institutionelle Archive sind normierte XML-basierte Formate empfehlenswert. Die Metadaten erlauben eine gezielte Recherche und machen Bestände langfristig auffindbar.
OCR und Texterkennung bei alten Programmen
Die Texterkennung durch OCR (Optical Character Recognition) ist abhängig von Schriftart, Papierqualität und Layout. Programme mit gebrochener Schrift, Handschrift oder typografischen Sonderzeichen sind schwer automatisierbar. Dennoch kann OCR – kombiniert mit manuellem Korrekturlesen – eine sinnvolle Erschließung ermöglichen. Moderne Tools wie Transkribus oder ABBYY FineReader sind speziell für historische Dokumente konzipiert.
Plattformen zur Präsentation digitaler Programme
Digitalisierte Kinoprogramme können über eigene Websites, Datenbanken oder öffentliche Plattformen zugänglich gemacht werden. Beispiele:
-
DDB – Deutsche Digitale Bibliothek
-
Europeana – Europäische Kulturplattform
-
museum-digital
-
Flickr Commons oder Wikimedia für gemeinfreie Inhalte
-
Eigene Onlinearchive mit Suchfunktion und Zoomtechnik
Auch Filmarchive und Universitäten bieten zunehmend Sammlungsportale mit Scans, Metadaten und Forschungszugang an.
Digitalisierung als Rettung vor Verfall
Viele historische Programme sind auf säurehaltigem Papier gedruckt und unterliegen natürlicher Zersetzung. Licht, Feuchtigkeit und Lagerungsfehler beschleunigen diesen Prozess. Die Digitalisierung ermöglicht zumindest den Erhalt des Informationsgehalts – auch wenn das haptische Original nicht dauerhaft gesichert werden kann. Besonders gefährdete Bestände (z. B. Programme vor 1945) sollten daher prioritär digitalisiert werden.
Was bleibt vom Original?
Trotz aller Vorteile kann ein digitales Abbild das Original nicht vollständig ersetzen. Druckstruktur, Papierklang, Geruch, Alterungsspuren und handschriftliche Ergänzungen bilden einen Teil des historischen Objekts. Für wissenschaftliche Analysen der Materialität oder konservatorische Arbeit bleibt das physische Original unerlässlich. Die Digitalisierung ist ein Zugang – kein Ersatz.
Rechtliche Aspekte digitalisierter Inhalte
Auch bei alten Programmen gilt: Urheberrecht, Leistungsschutz und Nutzungsrecht müssen beachtet werden. Viele Programme enthalten Bildmaterial, Texte oder Logos, die rechtlich geschützt sind. Abbildungen vor 70 Jahren können gemeinfrei sein – müssen es aber nicht zwingend. Vor Veröffentlichung empfiehlt sich eine Prüfung der Rechte oder eine Nutzung unter wissenschaftlichem Zitatrecht. Plattformen wie Europeana arbeiten mit klaren Lizenzmodellen (z. B. CC-BY, Public Domain Mark).
Quellen:
IFLA Guidelines for Digitization Projects
Europeana Publishing Framework
DFG-Praxisregeln Digitalisierung
Transkribus OCR for Historical Documents
Österreichische Nationalbibliothek: Digitales Sammlungsmanagement